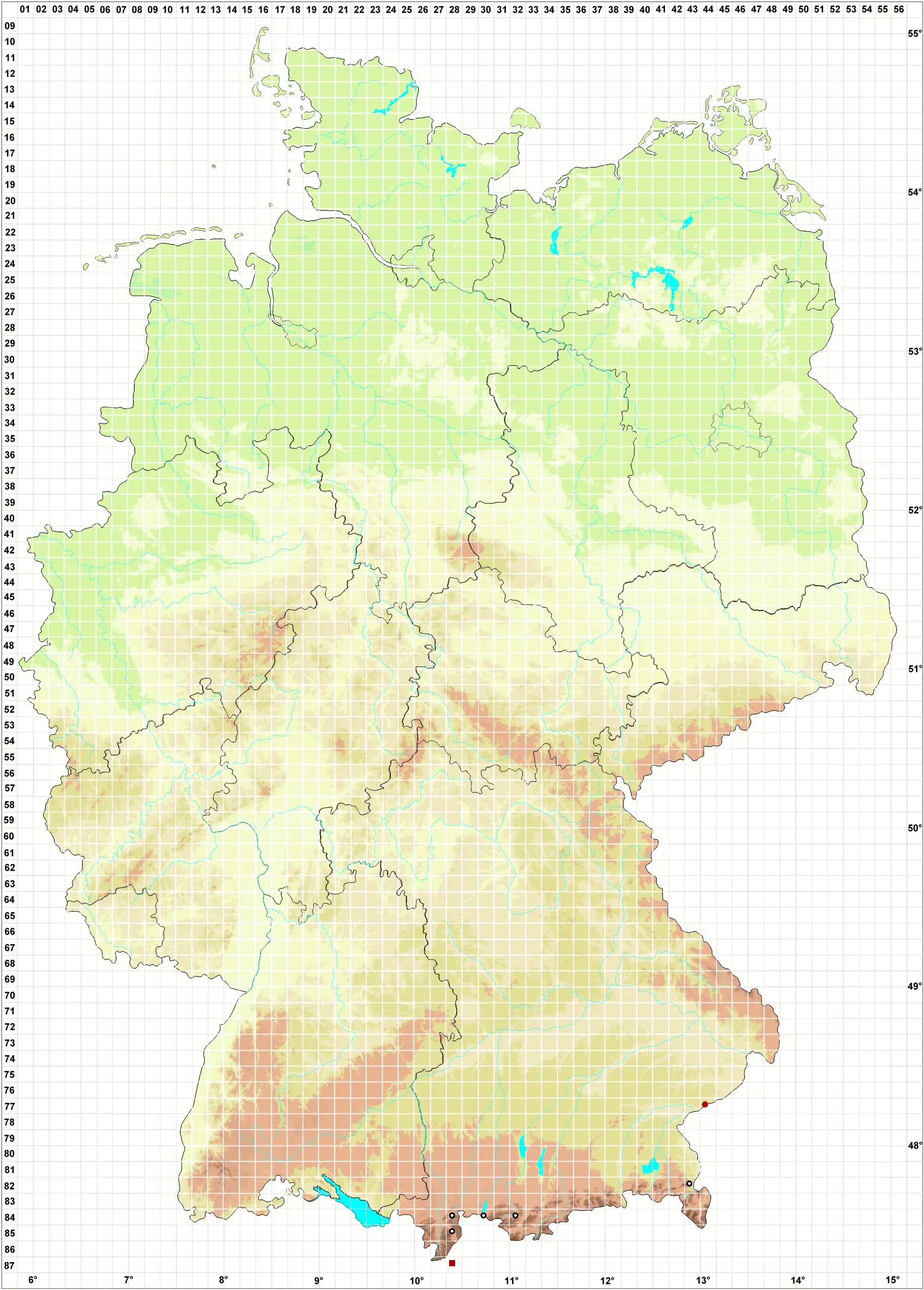In unserer Datenbank gibt es 3 Datensätze .
Bitte klicken Sie die Karte für Details. [ Verbreitung in Deutschland ]
[ Verbreitung in Deutschland ]
Fertilität
Höhenverteilung
Rote Liste
- Deutschland (2018): 1
- Bayern (2019): 1 / Alpen: 0 / kontinental: R
[ x ]
alpin: Alpen mit voralpinem Hügel- und Moorland
kontinental: Übriges Bayern
Gefährdungskategorien
Rote Liste 0 (Ausgestorben oder verschollen)
Rote Liste 1 (Vom Aussterben bedroht)
Rote Liste 2 (Stark gefährdet)
Rote Liste 3 (Gefährdet)
Rote Liste G (Gefährdung unbekannten Ausmaßes)
Rote Liste R (Wegen Seltenheit gefährdete Arten)
V Vorwarnliste
D Daten unzureichend
* Ungefährdet
♦ Nicht bewertet
Dürhammer, O. & M. Reimann (2019): Rote Liste und Gesamtartenliste der Moose (Bryophyta) Bayerns. – Bayerisches Landesamt für Umwelt Hrsg., Augsburg, 84 S.
Gebietseinteilungalpin: Alpen mit voralpinem Hügel- und Moorland
kontinental: Übriges Bayern
Gefährdungskategorien
Rote Liste 0 (Ausgestorben oder verschollen)
Rote Liste 1 (Vom Aussterben bedroht)
Rote Liste 2 (Stark gefährdet)
Rote Liste 3 (Gefährdet)
Rote Liste G (Gefährdung unbekannten Ausmaßes)
Rote Liste R (Wegen Seltenheit gefährdete Arten)
V Vorwarnliste
D Daten unzureichend
* Ungefährdet
♦ Nicht bewertet
Beschreibung der Art
Habitat/Ökologie (Meinunger & Schröder 2007)
Verbreitung (Meinunger & Schröder 2007)
Bestand und Gefährdung (Meinunger & Schröder 2007)
Verwandte Arten
- → Tortula acaulon var. papillosa (Lindb.) R.H.Zander
- → Tortula acaulon var. pilifera (Hedw.) R.H.Zander
- → Tortula acaulon (With.) R.H.Zander
- → Tortula acaulon (With.) R.H.Zander var. acaulon
- → Tortula aciphylla (Bruch & Schimp.) Hartm.
- → Tortula acuta Brid.
- → Tortula aestiva (Brid. ex Hedw.) P.Beauv.
- → Tortula aloides (Schultz) De Not.
- → Tortula alpina (Bruch & Schimp.) Bruch
- → Tortula ambigua (Bruch & Schimp.) Ångstr.
- → Tortula angustata Lindb.
- → Tortula atherodes R.H.Zander
- → Tortula atherodes var. curviseta (Dicks.) R.H.Zander
- → Tortula atherodes var. papillosa R.H.Zander
- → Tortula atherodes var. pilifera (Hedw.) R.H.Zander
- → Tortula atrovirens (Sm.) Lindb.
- → Tortula brevirostris Hook. & Grev.
- → Tortula brevissima Schiffn.
- → Tortula calcicola Grebe
- → Tortula calcicolens W.A.Kramer
- → Tortula canescens Mont.
- → Tortula caucasica Broth.
- → Tortula crassinervis De Not.
- → Tortula crinita (De Not.) De Not.
- → Tortula crinita (De Not.) De Not. var. crinita
- → Tortula crinita var. calva (Durieu & Sagot) Nebel & Heinrichs
- → Tortula crocea Brid.
- → Tortula cuneifolia (Dicks.) Turner
- → Tortula densa (Velen.) J.-P. Frahm
- → Tortula dicksoniana (Schultz) Podp.
- → Tortula euryphylla R.H.Zander
- → Tortula fiorii (Venturi) G.Roth
- → Tortula guepinii (Bruch & Schimp.) Broth.
- → Tortula hoppeana (Schultz) Ochyra
- → Tortula inclinata R.Hedw.
- → Tortula inermis (Brid.) Mont.
- → Tortula inermis var. inermis
- → Tortula intermedia (Brid.) Berk.
- → Tortula intermedia De Not.
- → Tortula intermedia var. calva (Durieu & Sagot) Wijk & Margad.
- → Tortula laevipila (Brid.) Schwägr.
- → Tortula laevipilaeformis De Not.
- → Tortula laevipila var. laevipilaeformis (De Not.) Limpr.
- → Tortula laevipila var. meridionalis (Schimp.) Wijk & Margad.
- → Tortula laevipila var. propagulifera Lindb.
- → Tortula laevipila var. wachteri Barkman
- → Tortula lamellata Lindb.
- → Tortula lanceola R.H.Zander
- → Tortula latifolia Bruch ex Hartm.
- → Tortula laureri (Schultz) Lindb.
- → Tortula leucostoma (R.Br.) Hook. & Grev.
- → Tortula limbata Lindb.
- → Tortula lindbergii Broth.
- → Tortula lingulata Lindb.
- → Tortula marginata (Bruch & Schimp.) Spruce
- → Tortula membranifolia Hook.
- → Tortula modica R.H.Zander
- → Tortula montana (Nees) Lindb.
- → Tortula mucronifolia Schwägr.
- → Tortula muralis Hedw.
- → Tortula muralis var. aestiva Brid. ex Hedw.
- → Tortula muralis var. muralis Hedw.
- → Tortula muralis var. obcordata (Schimp.) Limpr.
- → Tortula muralis var. obtusifolia (Schwägr.) Culm.
- → Tortula norvegica (F.Weber) Wahlenb. ex Lindb.
- → Tortula oblongifolia Wilson
- → Tortula obtusifolia (Schwägr.) Mathieu
- → Tortula pagorum (Milde) De Not.
- → Tortula pallida (Lindb.) R.H.Zander
- → Tortula papillosa var. meridionalis Warnst.
- → Tortula papillosa Wilson
- → Tortula papillosissima (Copp.) Broth.
- → Tortula papillosissima var. submamillosa (W.A.Kramer) Heinrichs & Caspari
- → Tortula princeps De Not.
- → Tortula protobryoides R.H.Zander
- → Tortula pulvinata (Jur.) Limpr.
- → Tortula revolvens (Schimp.) G.Roth
- → Tortula revolvens (Schimp.) G.Roth var. revolvens
- → Tortula revolvens var. obtusata Reimers
- → Tortula rhizophylla (Sakurai) Z.Iwats. & K.Saito
- → Tortula rhodonia R.H.Zander
- → Tortula rigida (Hedw.) Schrad. ex Turner
- → Tortula rotundifolia Hartm.
- → Tortula ruraliformis (Besch.) Ingham
- → Tortula ruraliformis var. subpapillosissima Bizot & R.B.Pierrot ex W.A.Kramer
- → Tortula ruralis (Hedw.) P. Gaertn., E. Mey. & Scherb.
- → Tortula ruralis subsp. calcicola (J.J.Amann) Giacom.
- → Tortula ruralis subsp. calcicolens (W. A. Kramer) Düll
- → Tortula ruralis subsp. ruraliformis (Besch.) Dixon
- → Tortula ruralis var. alpina Wahlenb.
- → Tortula ruralis var. arenicola Braithw.
- → Tortula ruralis var. calcicola (J.J.Amann) Barkman
- → Tortula ruralis var. calva (Durieu & Sagot) C.Hartm.
- → Tortula ruralis var. crinita De Not.
- → Tortula ruralis var. densa Velen.
- → Tortula ruralis var. ruraliformis (Besch.) De Wild.
- → Tortula ruralis var. submamillosa W.A.Kramer
- → Tortula ruralis var. virescens De Not.
- → Tortula saccardoana De Not.
- → Tortula schimperi M.J.Cano, O.Werner & J.Guerra
- → Tortula sinensis (Müll.Hal.) Broth.
- → Tortula sinuosa Mitt.
- → Tortula spadicea Mitt.
- → Tortula squamifera var. pottioidea De Not.
- → Tortula suberecta Hook.
- → Tortula subulata Hedw.
- → Tortula subulata var. angustata (Schimp.) Limpr.
- → Tortula subulata var. graeffii Warnst.
- → Tortula subulata var. subinermis (Bruch & Schimp.) Wilson
- → Tortula systylia (Schimp.) Lindb.
- → Tortula tortuosa Ehrh. ex Hedw.
- → Tortula truncata (Hedw.) Mitt.
- → Tortula vahliana (Schultz) Mont.
- → Tortula vectensis E.F.Warb. & Crundw.
- → Tortula velenovskyi Schiffn.
- → Tortula virescens (De Not.) De Not.
- → Tortula virescens var. mutica Nebel & Heinrichs
- → Tortula vlassovii (Laz.) Ros & Herrnst.